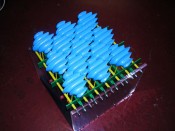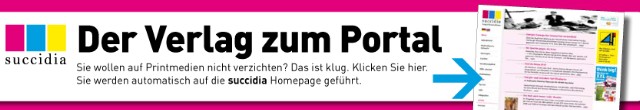|
Intelligente Anwendungen – von den Jägern der Meere abgeschaut
Intelligente Anwendungen – von den Jägern der Meere abgeschaut
2,5 Tonnen Kerosin weniger, 15 Passagiere mehr, 1,5 Sekunden schneller, keine Antifouling-Farben mehr. Was haben diese vier Punkte gemeinsam? Diese vier Aussagen treffen auf das Potenzial einer bestimmten Oberflächenstruktur zu, die von der Natur abgeschaut ist. Die Schuppen der Haifischhaut dienen als Vorbild für die Reibungsminimierung von Oberflächen (Abb. 1).

Ein mit einer der Haifischhaut nachempfundenen Folie beklebtes Flugzeug kann bei einem Langstreckenflug ca. 2,5 Tonnen Kerosin einsparen. Durch das eingesparte Kerosin könnten bis zu 15 Passagiere mehr mit an Bord genommen werden. Die in den letzten Jahren heiß diskutierten Schwimmanzüge machten die Hochleistungssportler auf 100m im Schnitt um 1,5s schneller. In der Schifffahrt kann die Beschichtung umweltgefährliche Antifouling-Farben ersetzen.
Energieeinsparung durch Minimierung des Reibungswiderstandes
Das Prinzip der Reibungswärme ist ein aus dem Alltag bekanntes Phänomen. Bewegungsenergie wird hier durch Reibung zweier Körper in Wärmeenergie umgewandelt. In den oben angesprochenen Fällen treten ähnliche Effekte auf, die dazu führen, dass ein Mehraufwand an Energie für die Fortbewegung benötigt wird. Dort werden die bewegten Körper von einem Fluid umströmt. Zusätzlich zum Reibungswiderstand treten je nach Bauform an bestimmten Stellen des umströmten Körpers bremsende Turbulenzen im Fluid auf. Schon seit den 90er-Jahren arbeiten Forscher daran, das Vorbild der Haifischhaut für Projekte in der Technik zu nutzen. Die Minimierung des Reibungswiderstandes sowie die Optimierung von turbulenten Strömungen standen seit dieser Zeit im Mittelpunkt der Forschung.
Materialforschung trifft Strömungsmechanik
In der Strömungsmechanik unterscheidet man generell zwischen laminarer und turbulenter Strömung (siehe dazu nebenstehende Infobox). Nur bei perfekter laminarer Umströmung des Körpers würde kein Widerstand durch Bildung von Turbulenzen auftreten. Wird ein realer Körper von einem Medium umströmt, tritt in der Regel eine Mischung aus beiden Strömungsformen auf. Eine Minimierung des turbulenten Anteils führt also zu einer Reduktion des Strömungswiderstandes. Diese Optimierung steht neben der materialwissenschaftlichen Suche nach geeigneten Werkstoffen im Fokus vieler Forschungsgruppen.
Computersimulation löst mechanische Modelle ab
Bereits 1992 wurde Dietrich Bechert vom Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt der TU Berlin der erste Bionik-Preis für sein Modell zur Verminderung des Strömungswiderstandes nach Vorbild der Haifisch-Schuppen (Abb.2) verliehen. Hier wurden große Abbilder der Schuppen angefertigt. Wurden diese dann überströmt, konnte man mit Mikrowaagen die Belastung an den einzelnen Stellen messen und somit den Widerstand einer speziellen Form beschreiben. Im Zeitalter der Hochleistungsrechner bietet sich hier eine wesentlich zeitsparendere Methode, um solche Strukturen zu optimieren.
Abb.1 Die raue Struktur der Haifischhaut wird unter dem Rasterelektronenmikroskop sichtbar.
Bild: J. Oeffner & G.V. Lauder (2012), J. Exp. Biol. 215, 785–795, mit freundlicher Genehmigung
Abb.2 Modell einer 600-fach vergrößerten Haut eines Hammerhais
Bild: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Institut für Antriebstechnik AT-TRA, mit freundlicher Genehmigung
Abb.3 Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer ribletstrukturierten Lackoberfläche
�Bild: © Fraunhofer IFAM
Schwimmanzug besteht aus zwei verschiedenen Materialien
Bei der neuesten Generation der Fastskin Schwimmanzüge der Firma Speedo wurden auf Grundlage von numerischer Simulation diejenige Zonen am Körper identifiziert, auf denen der meiste Druck herrscht. Hierzu wurden die Körper verschiedener Athleten vermessen. Weiterhin ist es möglich, potenzielle Stellen für Turbulenzen mittels Simulation zu identifizieren. Diese Ergebnisse mündeten in einem Anzug, der aus zwei verschiedenen Kunststoffen mit unterschiedlichen Härten und unterschiedlicher Oberflächenstruktur besteht. Auch die Schuppen des Haifischs haben übrigens unterschiedliche Härten an verschiedenen Stellen.
Schifffahrt und Biofouling
Ein weiteres Beispiel für eine praxistaugliche Anwendung ist die vom Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung entwickelte Lackierung, bei der die Struktur während der Aufbringung eines Lackes entsteht (Abb. 3). Eingesetzt wird das unter dem Namen „Hai-Tech“ bekannte Projekt in der Schifffahrt. Neben der Treibstoffkostenreduzierung lassen sich hier weitere Kosten sparen. Durch geringere Ablagerungen an den Wänden der Schiffe müssen keine giftigen Antifoulinglacke verwendet werden und Reinigungskosten können gesenkt werden.
Fazit und Ausblick: Anwendung und Einfluss auf Energietechnik
Grundsätzlich lassen sich solche speziellen Oberflächenstrukturen überall dort einsetzen, wo Körper von Fluiden umströmt werden und der Strömungswiderstand herabgesetzt werden soll. Eine potenzielle Anwendung ist zum Beispiel die Beschichtung von Windrädern, um deren Wirkungsgrad zu erhöhen und somit mehr Energie zu gewinnen. Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist auch der Einfluss auf den Emissionshandel. Werden Transportmittel hier mit einbezogen, bietet sich zusammen mit dem eingesparten Treibstoff ein doppeltes Sparpotenzial. Die hier angesprochenen Aspekte zeigen: Bei der Natur hinschauen lohnt sich!
LH
Foto: © panthermedia.net, Magdalena Walter
Stichwörter:
Reibungsminimierung von Oberflächen, Reibungsminimierung, Haifischhaut, Materialforschung, Strömungsmechanik, Verminderung Strömungswiderstand, Fastskin Schwimmanzüge, Speedo Schwimanzug, Speedo, Biofouling, Hai-Tech,
|