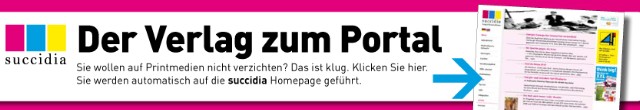|
Neueste Entwicklungen aus der Sensorik und Messtechnik
Neueste Entwicklungen aus der Sensorik und MesstechnikBranchenübergreifende InnovationskraftSensorik und Messtechnik sind von zentraler Bedeutung in allen wichtigen Industriebranchen, sie zählen zu den wichtigsten Schlüsseltechnologien für technische Innovationen, insbesondere im Bereich der Automation. In immer komplexer vernetzten Produktionsprozessen liefern Sensoren und Systeme die wichtigen Informationen und unterstützen deren Verarbeitung. Sensorik und Messtechnik sind elementar, um effiziente und kostensparende Prozesse zukunftsfähig zu gestalten. In Nürnberg standen auf der Sensor+Test vom 14.–16. Mai 2013 aktuelle Entwicklungen im Fokus. Parallel zur Fachmesse trugen Vertreter aus Wissenschaft und Industrie die neuesten Forschungsergebnisse zu einem breiten Themenspektrum auf den AMA-Kongressen 2013 (Sensor, Opto und IRS2) vor. chemie&more war im Gespräch mit Herrn Prof. Dr.-Ing. Roland Werthschützky, der dem Fachgebiet Mess- und Sensortechnik der Technischen Universität Darmstadt vorsteht und als Mitglied des Wissenschaftsrates des „AMA-Fachverbandes für Sensorik“ den Sensor-Kongress gemeinsam mit Prof. Dr. Reinhard Lerch, Universität Erlangen-Nürnberg, fachlich leitete. chemie&more: Herr Professor Werthschützky, zunächst einmal wollen wir zu einer gelungenen Veranstaltung in Nürnberg gratulieren. Können Sie uns einen kurzen Überblick geben zu den wesentlichen Themen, die auf dem diesjährigen SENSOR-Kongress präsentiert wurden? Die AMA-Kongresse finden im jährlichen Wechsel mit der nationalen VDI/VDE-Tagung Sensoren und Messsysteme statt. Der internationale Kongress SENSOR wurde in diesem Jahr zum 16. Mal durchgeführt. Damit hat sich die Nürnberger Messe zum jährlichen Treffpunkt der Sensor- und Messtechnikspezialisten aus der Industrie und den Instituten in Deutschland etabliert. Die internationale Reputation hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht. Das diesjährige Kongressprogramm umfasste vier Plenarvorträge sowie 170 Fachvorträge und 45 Poster. Die Beiträge wurden in 44 Sitzungen, die z.T. fünfzügig parallel verliefen, präsentiert. Insgesamt nahmen ca. 400 Teilnehmer aus 29 Ländern teil. Die fachlichen Schwerpunkte umfassten bei den Grundlagen die Modellbildung und Simulation beim Entwurf von Sensoren, deren Wirkprinzipien zur Erfassung mechanischer, thermischer und chemischer Größen, die integrierte störungsarme Sensorsignalverarbeitung und die kontaktlose Energie- und Signalübertragung. Einen zweiten Schwerpunkt bildeten Beiträge zur Sensorgehäusung, zur Sensorfertigung sowie zum Sensortest und zur Kalibrierung. Die Anwendungen konzentrierten sich vor allem auf Sensoren für mechanische Größen wie Durchfluss, Druck und Kraft sowie Bio- und Gassensoren. Der SENSOR-Kongress zeichnete sich in diesem Jahr durch ein erweitertes Programm aus. Neben physikalischen Prinzipien, Sensortechnologien, Sensorelektronik und Applikationen boten Sie einen Schwerpunkt zum Thema Gassensoren an. Was sind hier die Hintergründe? Den Motor bei der Entwicklung moderner Gassensoren sehe ich vor allem in der Nutzung von Forschungsergebnissen zu neuartigen physikalischen und chemischen Sensoreffekten. Damit war der zunehmende Einsatz von Massentechnologien wie Halbleiter- und Dünnschichttechnologien möglich. Als Ergebnis liegen jetzt relativ kostengünstige, miniaturisierte Gassensoren vor, die zunehmend Onlinemessungen ermöglichen. Eine wesentliche Triebkraft dieser Entwicklung war und ist die Kfz-Technik. Hier setzte die Entwicklung mit der Lamda-Sonde ein. Aber auch in der Verfahrenstechnik werden diese Sensoren zunehmend die bisherigen Offlinegeräte ersetzen. Ein weiteres wichtiges Anwendungsgebiet ist die Sicherheitstechnik, z.B. die Luftüberwachung in Städten und im Umkreis chemischer Betriebe. Die Bedeutung der Durchflussmessung, also des Messens von Gasen, Dämpfen oder Flüssigkeiten für die Prozessindustrie spiegelt sich auch in der Vielfalt der angebotenen Geräte und Gerätetechniken wider. Was sind hier die aktuellen Herausforderungen und wohin geht die Entwicklung in der Durchflussmessung? Gestatten Sie mir eine Vorbemerkung: Die Beiträge auf den Kongressen sind konzentriert auf die Anwendungsschwerpunkte der vor allem mittelständisch geprägten AMA-Mitglieder wie Maschinenbau, Fahrzeugtechnik, Consumer-Technik und Labormesstechnik. Relativ schwach ist leider die Prozessmesstechnik in den Bereichen der Chemie, Kraftwerkstechnik und Metallurgie vertreten. Hier sehe ich für die Zukunft ein sehr wichtiges Erweiterungsfeld, zumal auf der nationalen Automatisierungstagung in Baden-Baden die Prozessmesstechnik nicht mehr vertreten ist. Aufgrund der herausragenden Bedeutung der Durchflusstechnik auch in den gegenwärtigen „AMA-Anwendungsgebieten“ bildete sie in den letzten zehn Jahren stets einen besonderen Schwerpunkt auf dem Kongress. Auch diesmal waren zwei Sitzungen der Durchflusssensorik gewidmet. Die Durchflussmessung ist durch eine Vielzahl von Messverfahren aufgrund der sehr spezifischen Anwendungsanforderungen gekennzeichnet. Natürlich geht der Trend eindeutig in Richtung berührungsloser Verfahren wie Coriolis-Kraft-, elektrodynamische (MID) und US-Sensoren. Trotzdem sollte man vorsichtig bei Vorhersagen zu Ablösungstrends traditioneller Messverfahren sein. So hat man bereits vor zwanzig Jahren die drastisch abnehmende Bedeutung von Wirkdruckverfahren, also Blenden- und Düsenmessungen, vorausgesagt, aber etablierten Sensorfirmen verzeichnen heute auf diesem Gebiet zunehmende Umsätze. Wichtig ist also auch das vorhandene Vertrauen der Anwender, die Robustheit und Zuverlässigkeit sowie der Standardisierungsgrad der Durchflussmessverfahren. Einen interessanten Lösungsansatz, vor allem für feste Stoffe, sehe ich im Einsatz von Teraherz-Sensoren. Diese elektrodynamischen Wellenausbreitungsverfahren sichern das berührungslose Messen von festen Stoffen bei einer hohen Auflösung. Allerdings befinden sich die Arbeiten hierzu noch im Forschungsbereich. In der Prozessindustrie sind schon lange optische Temperaturmessverfahren im Einsatz. Die Anwendungsbereiche sind hier sehr vielfältig. Welche Rolle spielen berührungslose Messverfahren? Wie bei der Durchflussmesstechnik bereits erwähnt, geht der Trend eindeutig in Richtung berührungsloser Messverfahren. Ihr großer Vorteil besteht in der Rückwirkungsfreiheit des Sensors auf die Messgröße, d.h., eine Signalverfälschung wie bei den berührenden Verfahren wird grundsätzlich vermieden. Bei Sensoren für mechanische Größen ist die Ausschlagsmethode, also der Erfassung von Dehnungen und Ausschlägen von Metall-, Keramik-. und Silizium-Verformungskörpern, am weitesten verbreitet. Gegenwärtig werden hierzu vor allem resistive oder piezoresistive Dehnungselemente sowie kapazitive Messelemente verwendet. Berührungslose optische Verfahren haben hier bei vergleichbaren Fertigungskosten und Störfestigkeit eine Chance. Ich sehe sie aber eher nach wie vor auf dem Gebiet der Präzisionsmesstechnik. Außerdem „belastet“ natürlich auch bei optischer Abtastung der Verformungskörper die Messgröße. Zum Thema Wireless – dieser Trend zog sich quer durch die Hallen der SENSOR+Test und stand auch auf der Agenda des SENSOR-Kongresses. Welche Bedeutung haben Wireless-Technologien für innovative Entwicklungen und Anwendungen? Wireless-Technologien sind heute Stand der Technik. Durch den Einsatz dieser Technologien, vor allem durch aktive Funkübertragung oder passive induktive Übertragung, wurden neue, vorzugsweise mobile Anwendungen erschlossen. Dieser Trend wird sich durch die Verbesserung der Sicherheitsstandards fortsetzen. Bedingt durch physikalische Randbedingungen wie begrenzte Reichweite, Einfluss von elektrostatischen und magnetischen Störungen, die Abschottung durch metallische Materialien sowie Zugriffsprobleme bei Funklöchern sind hier jedoch auch Grenzen bei der Verlässlichkeit der Sensor-Signalübertragung gesetzt. Industrie 4.0 war das große Thema auf der Hannover Messe 2013, die zunehmende Vernetzung aller Bereiche der Industrie und die Steuerbarkeit von Anlagen über webbasierte Technologien standen im Mittelpunkt. Welche Rolle spielen hier Sensorik und Messtechnik? Am Anfang der Kette der technischen Informationsverarbeitung stehen in allen Anwendungsfeldern immer Sensoren. Daher sind Fortschritte bei dieser Thematik nur durch kontinuierliche Weiterentwicklungen der Sensor- und Messtechnik möglich. Welche Forschungs- und Entwicklungstrends werden zukünftig für die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen im Bereich Sensorik und Messtechnik auf den internationalen Märkten maßgeblich sein und welche Rolle spielt hier die akademische Forschung? Für die Zukunft sehe ich folgende Entwicklungsschwerpunkte: // Vervollkommnung der Reproduzierbarkeit und Langzeitstabilität der physikalischen Wandlungsprinzipien von Primärsensoren durch Weiterentwicklung bekannter oder Einführung neuer Technologien. // Die Verbesserung der Rückwirkungsfreiheit und Robustheit der Sensorgehäusung bei gleichzeitiger Einführung neuartiger, kostengünstigerer Fertigungstechnologien. Gerade diese Problematik ist entscheidend für die Einführung neuer Sensorprinzipien oder Messverfahren in die industrielle Nutzung. Sie wird aus meiner Sicht in der institutionellen Forschung vernachlässigt. // Die Erweiterung des Funktionsumfangs der integrierten Sensorelektronik vor allem durch Selbstüberwachung und Selbstrekonfiguration gestörter oder ausgefallener Primärsensoren. // Die Strukturintegration miniaturisierter und vernetzter Primärsensoren mit zentraler autarker Sensorelektronik und Übertragungsmodul zur Überwachung von Bauteilbeanspruchungen oder zur Strukturadaption. // Die verstärkte direkte Sensor-Aktor-Kopplung, z.B. Sensorintegration in Pumpen zur Arbeitspunkt- und Zustandsüberwachung, aber gleichzeitig auch zur Erfassung der Prozessgrößen. // Die verstärkte Integration der Sensoren in die digitale Umwelt. Sensor-Aktor-Systeme werden über Cloud Computing zu einem Cyber-Physical-System vernetzt. Diese Themenfelder stehen teilweise bereits heute im Mittelpunkt der akademischen Forschung. An den Universitäten ist diese Forschungstätigkeit Voraussetzung für einen international hohen Standard in der Lehre. Obwohl das sicher nur einige Zukunftsfelder sind, ist bereits daraus erkennbar: Für die Mess- und Sensortechniker gibt es in der nahen Zukunft ausreichend Forschungs- und Entwicklungsbedarf. Herr Professor Werthschützky, wir bedanken uns herzlich für das Gespräch. (Interview: Claudia Schiller, Horst Holler) Foto: © panthermedia.net, Milan Milakovic |
C&M 3 / 2013
Das komplette Heft zum kostenlosen Download finden Sie hier: zum Download Weitere Artikel online lesenNewsAhlborn GmbH: Hochgenaue Temperaturmessung mit digitalen FühlernBei über 80 % aller industriellen Messaufgaben werden Temperaturen gemessen. Wichtig ist das Zusammenspiel von Messgerät und Fühler sowie die verwendete Technologie. Aus der Präzisionsschmiede, der Firma Ahlborn aus Holzkirchen bei München, kommt jetzt ein Messsystem für hochgenaue Temperaturmessung, das nicht nur im Labor verwendet werden kann.© Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH |
Suche: