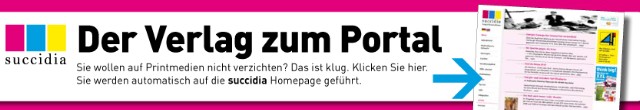|
Wankel und Wasserstoff
Wankel und Wasserstoff– ein Schattendasein oder zurück in die Zukunft
Wankel 1967 – Der NSU Ro80 mit Rotationskolbenmotor war damals der Star der IAA. Der Traum vom Wankelmotor als Antrieb der Zukunft währte allerdings nicht lange, Produktionsende war 1977.
Was würden wir dafür geben, wenn wir wüssten, wie die Welt in hundert Jahren aussieht? Wären dann zwei Techniken, die schon lange zurückliegende Erfindung des Wankelmotors von Felix Wankel und die noch im Forschungsstadium befindliche Wasserstoffsynthese aus Grünalgen von Bedeutung? Die Funktionsweise des Wankelmotors beruht auf der Trennung des Verbrennungsablaufes. Der Wankelmotor der heutigen Zeit weist im Grunde nur noch drei Teile auf. Das Patent wurde 1961 vom Autobauer Mazda mit Firmensitz in Hiroshima übernommen. Als Endergebnis wurden Teile des Motors in ihrer Anzahl radikal reduziert und der Motor sozusagen als Motorblock aus einem Guss hergestellt. Gleichzeitig wurden die Drehzahl erhöht und der Brennraum anstatt mit einer Zündkerze nun zeitnah doppelt gezündet. Gegenwärtig besteht eine ähnliche Situation wie vor 1961. In Deutschland ist kein Wankel bei irgendeinem Autohersteller kommerziell verfügbar. Nur wenige gebrauchte Wankel sind noch auf dem Markt. Um 1961 waren nur wenige Ro 80 der Firma Audi-NSU käuflich erhältlich. Audi stellte die Wankelproduktion ein, wurde von VW übernommen und verkaufte das Patent nach Japan. Die Leistung eines Wankelmotors im Wasserstoffbetrieb sinkt um 50?% im Vergleich zum Betrieb mit herkömmlichem fossilen Kraftstoff. In der kritischen Betrachtung wird auch die Gefährlichkeit des Wasserstoffantriebes aufgeführt. Interessant ist, dass derartige Fahrzeuge in Tokio im Taxibetrieb und auf der HyNor in Norwegen im Dauerbetrieb eingesetzt werden. Bekannt ist auch, dass eine Tankstelle mit herkömmlichem Treibstoff leichter entzündbar ist als eine Wasserstofftankstelle, da Wasserstoff flüchtig ist. Es läuft lediglich eine Knallgasreaktion mit Sauerstoff ab, an deren Ende als Reaktionsprodukt H2O entsteht. Die offene Frage beim Verkehrsunfall mit Fahrzeugen im Wasserstoffbetrieb löst ein Nanopartikelspeicher im Tank. Die Wasserstofftanks sind deformierbar mit Druckreduzierung im Falle eines Unfalles und es besteht durchaus die Einschätzung, dass die Gefahren des Wasserstoffs geringer sind als die des konventionellen Treibstoffes, weil Wasserstoff verdampft. Das energetische Potenzial des Wasserstoffes und seine energetisches Speicherpotenzial machen Wasserstoff zu einer Zukunftstechnologie. Mit dieser Wortwahl platziert man die Wasserstofftechnologie als eine der Technologien, die in 20?–?30 Jahren sicherlich kommen wird. Bei genauer Betrachtungsweise ist diese Technik schon heute realisierbar. Es gibt bereits Wasserstofftankstellen für Kleinbetriebe. Dazu erfolgt bis jetzt die Erzeugung von Wasserstoff durch Wasserspaltung mittels Strom, der aus fossilen Brennstoffen hergestellt wird. Diese wiederum sind entweder als Ölvorräte begrenzt oder der dafür genutzte Strom setzt ein AKW voraus. Alternativ wird der Strom zur Wasserspaltung aus direkt einspeisenden Solarmodulen oder Kleinwindrädern gewonnen. Eine weitere Quelle ist in der chemischen Industrie zu finden, wo Wasserstoff anfällt. Die Möglichkeit der Biologie schlechthin, die Gewinnung des Wasserstoffs durch Algen, wird bislang nur in geringem Umfang genutzt. Zum heutigen Zeitpunkt sind Fördergelder für diese Forschung geflossen, die aufgrund der geringen Höhe eindeutig zeigen, dass dem Bekanntwerden der nachfolgend beschriebenen Technik klare Grenzen gesetzt werden sollen. Unter ungünstigen Wachstumsbedingungen, dem Entzug von Schwefel, produziert die Grünalge Chlamydomonas reinhardtii, ein mikrometergroßer kugelförmiger Hüllenflagellat, Wasserstoff mit einem Reinheitsgrad von über 90%. Die dazu notwendige Energie wird durch die Fotosynthese geliefert. Diese Grünalgenart ist weltweit verbreitet, lebt im Süßwasser und wird vorzugsweise in nährstoffreichen Kleingewässern angetroffen. Eine genetische Modifikation von C. reinhardtii ermöglicht höhere Ausbeuten von gasförmigem Wasserstoff, sodass die Entwicklung von leistungsfähigen Bioreaktoren zur Wasserstofferzeugung am Ort des Verbrauches denkbar ist. 1 Liter Algen produzieren ca. 750mL Wasserstoff. Die Algenwildformen schaffen ca. 0,1%, die genetisch modifizierte Alge immerhin 2,0 bis 2,4%. Wasserstoff ist ein Speichermedium und kann die fehlende Grunddienstbarkeitsfähigkeit der Wind- und Sonnenenergie liefern. Audi stellt gegen den Widerstand des VW-Konzerns einen A1-etron-Wankel als Studie vor. Linde beziffert die Kosten für ein flächendeckendes Wasserstoffnetz (der Firma Linde über Deutschland) in Deutschland auf 3 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Geldfluss der heutigen Zeit eine vergleichsweise bescheidene Summe. Literatur beim Autor. Foto: Audi AG |
C&M 1 / 2012
Das komplette Heft zum kostenlosen Download finden Sie hier: zum Download Die Autoren:Weitere Artikel online lesenNewsAhlborn GmbH: Hochgenaue Temperaturmessung mit digitalen FühlernBei über 80 % aller industriellen Messaufgaben werden Temperaturen gemessen. Wichtig ist das Zusammenspiel von Messgerät und Fühler sowie die verwendete Technologie. Aus der Präzisionsschmiede, der Firma Ahlborn aus Holzkirchen bei München, kommt jetzt ein Messsystem für hochgenaue Temperaturmessung, das nicht nur im Labor verwendet werden kann.© Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH |
Suche: